
Dialog mit der Politik
Nicht nur vor Ort, bei Krisen und Katastrophen, leistet CARE Hilfe für Menschen in Not. Auch auf politischer Ebene setzen wir uns Tag für Tag im Rahmen unserer Advocacy-Arbeit (dt. „Anwaltschaftsarbeit“) für die Rechte von Frauen und Mädchen, ihre Beteiligung an der Lösung humanitärer Notlagen und gegen den Klimawandel ein.
Nicht nur vor Ort, bei Krisen und Katastrophen, leistet CARE Hilfe für Menschen in Not. Auch auf politischer Ebene setzen wir uns Tag für Tag im Rahmen unserer Advocacy-Arbeit (dt. „Anwaltschaftsarbeit“) für die Rechte von Frauen und Mädchen, ihre Beteiligung an der Lösung humanitärer Notlagen und gegen den Klimawandel ein.
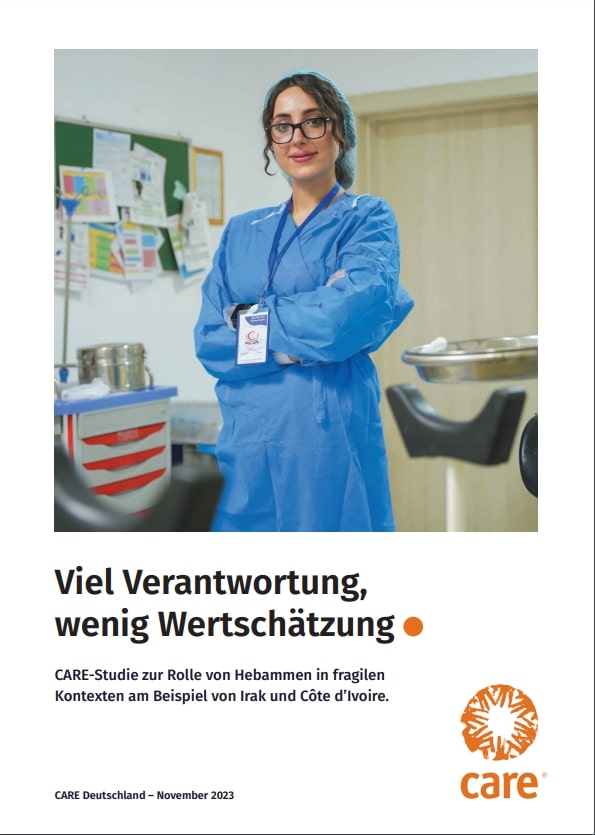
Neue Studie: Viel Verantwortung, wenig Wertschätzung
Um bestehende Bedarfe zu decken, fehlen weltweit in etwa 900.000 Hebammen. In einer neuen Fachstudie zeigt CARE am Beispiel von Hebammen im Irak und in Côte d’Ivoire wie diese als Akteurinnen des Wandels täglich durch persönlichen Einsatz ressourcenschwache und teils dysfunktionale Systeme ausgleichen.
Warum CARE sich politisch einmischt
Für unsere Projekte vor Ort sind Rahmenbedingungen auf nationaler und internationaler Ebene wichtig. Dies hat viele Dimensionen:
- Mit guten Gesetzen kann das Leben von vielen Menschen verbessert werden. Statt nur einige wenige Gemeinden zu erreichen, profitiert von Gesetzen das ganze Land.
- Wenn Hindernisse bestehen, zum Beispiel beim Zugang zu Nothilfebedürftigen Menschen, kann politischer Druck von wichtigen internationalen Akteuren wie der deutschen Bundesregierung positive Auswirkungen auf die Konfliktparteien und ihre Haltung zu Hilfslieferungen haben.
- Und nicht zuletzt verschaffen wir mit unserer politischen Arbeit den betroffenen Menschen, die sonst wenig oder gar nicht gehört werden, Gehör in nationalen Foren wie dem Bundestag oder internationalen Gremien wie der UN oder EU.
CARE sieht sich als Verbindung und Brücke zwischen unseren Projekten vor Ort und deutschen Entscheidungsträger:innen: wir beraten Abgeordnete im Bundestag und den zuständigen Ministerien mit dem Fachwissen und den Erfahrungen, die wir aus unseren Projekten vor Ort gewinnen. Wir klären auf über die Situation vor Ort und sprechen politische Empfehlungen aus. Und manchmal kritisieren wir politische Entscheidungen, um Verbesserungen für die Menschen vor Ort und einen sicheren und verlässlichen Rahmen für unsere humanitäre Arbeit zu erreichen.
Dabei konzentriert sich CARE in Deutschland vor allem auf drei Bereiche:
Gendersensible humanitäre Hilfe
Sowohl Naturkatastrophen als auch vom Menschen ausgelöste Krisen treffen Frauen, Mädchen, Männer und Jungen unterschiedlich: Frauen und Mädchen sterben statistisch jünger in einer Katastrophe. Überleben sie das Unglück, stehen sie anderen Gefahren und Schwierigkeiten gegenüber als Männer und Jungen.
Eine Frau im Konfliktgebiet zu sein, bedeutet doppelte Hürden, Gefahren und Schmerzen zu erleiden. Zwar haben Frauen natürlich die gleichen Grundbedürfnisse wie Männer und Jungen und sind auf ein sicheres Dach über dem Kopf, Nahrung und Wasser, medizinische Grundversorgung und Bildung angewiesen.
Aber Frauen und Mädchen benötigen auch frauenspezifische Unterstützung und Schutz: bei der Monatshygiene, der Familienplanung, bei Schwangerschaft und Geburt sowie der Sicherheit auf den Straßen und zu Hause. Darüber hinaus aber auch bei der Wahrung ihrer Rechte, gleichen Chancen auf dem Arbeitsmarkt und ihren Mitspracherechten.
Wer Frauen nicht gleich zu Beginn einer Krise einbezieht, der tut es meist auch später nicht mehr. Die Folgen sind gravierend: geschlechtsbedingte Ungleichheitenverschärfen sich, Diskriminierungen nehmen zu und Frauen werden – manchmal um Generationen – in ihrem Streben nach gleichen Rechten zurückgeworfen.
Wie nachlässig mit dem Bereich gendersensibler humanitärer Hilfe umgegangen wird, zeigt auch der Mangel an Daten: In der COVID-19-Pandemie hat nur ein Bruchteil der Regierungen auf der Welt Statistiken erhoben, wie sich die Situation speziell auf Frauen und Mädchen ausgewirkt hat - eine Lücke, die es schwer macht, Bedarfe festzustellen und gezielte Hilfe zu leisten.
Was für COVID gilt, stimmt auch für das Große und Ganze: viel zu wenig werden gezielt Zahlen in Krisen und Konflikten erhoben, die nach Geschlecht und Alter aufgeschlüsselt sind. Und auch, wieviel Geld in besonders auf die Bedürfnisse von Frauen und Mädchen zugeschnittene Hilfen investiert wird, ist nicht transparent bekannt. So wird eine große Chance vertan, denn die Herangehensweise von humanitären Akteuren und Geberstaaten während einer humanitären Hilfsaktion kann bestehende Ungleichheiten verstärken, im Umkehrschluss aber auch abbauen.
Bei CARE ist die Integration von Geschlechtergerechtigkeit in jede Phase von Nothilfe zentraler Bestandteil unseres humanitären Mandats.
Von der Bundesregierung fordert CARE deshalb:
- Eine Selbstverpflichtung zu einer konsequent gendersensiblen humanitären Hilfe. Ein deutsch-finanziertes Projekt, das die speziellen Bedürfnisse von Frauen und Mädchen nicht in den Blick nimmt, darf es in der Zukunft nicht mehr geben. Voraussetzung hierfür sind obligatorische gendersensible Bedarfsanalysen, ein ausdefinierter gendertransformativer Ansatz sowie die gezielte Förderung von Kapazitäten lokaler Frauenorganisationen und -netzwerke.
- Ambitionierte Finanzierungsziele für die Bereiche geschlechtsspezifische Gewalt sowie sexuelle und reproduktive Gesundheit und Rechte. Deutschland muss dazu beitragen, dass die internationale Finanzierungslücke in diesen Bereichen geschlossen wird.
- Gezielte Unterstützung bei der Teilhabe von Frauen und Mädchen auf allen Ebenen. Die Rolle von Frauen als Ersthelferinnen und Akteurinnen im humanitären Kontext muss gefördert werden. Aber dies muss auch mit politischer Teilhabe auf allen Ebenen ergänzt werden. Hierfür braucht es gezielte, transparente und nachhaltige finanzielle und politische Förderung.
Beteiligung von Frauen und Mädchen
Frauen und Mädchen sind häufiger von Armut betroffen, haben weniger Zugang zu Bildung und Gesundheitsversorgung und sind häufiger geschlechtsspezifischer Gewalt ausgesetzt. Entscheidungen werden dagegen meist von Männern getroffen. Die Stimmen von Frauen werden häufig nicht gehört, ihre Expertise nicht berücksichtigt und ihre Bedürfnisse ignoriert.
Frauen dürfen an vielen Orten der Welt weder bei politischen Prozessen mitsprechen noch wenn es um ihre eigene körperliche Selbstbestimmung und Unversehrtheit geht. Sie können nicht frei entscheiden, ob und wann sie medizinische Versorgung in Anspruch nehmen, sie sind in fast jeder Kategorie von Führungspositionen unterrepräsentiert. Insbesondere junge Frauen sowie Frauen aus marginalisierten und diskriminierten Gruppen sind besonders oft von Entscheidungsprozessen und Führungspositionen ausgeschlossen. Nur 0,2 Prozent der bilateralen Hilfe in fragilen und konfliktbetroffenen Gebieten erreicht direkt lokale Frauen(rechts)organisationen, die sich vor Ort für die Bedürfnisse von Frauen und Mädchen engagieren.
CARE ist überzeugt, dass Frauen und Mädchen Teil der Diskussionen und Entscheidungsprozesse sein müssen, um gute Antworten und Lösungen für Herausforderungen zu finden. Die Partizipation von Frauen und Mädchen ist sowohl ein grundlegendes Menschenrecht als auch ein effektiver Weg, um humanitäre und entwicklungspolitische Ziele zu erreichen. Programme und politische Maßnahmen, die von Frauen und Mädchen mitgestaltet werden, erzielen bessere Ergebnisse in Bezug auf Gerechtigkeit, Zugang zu Gesundheitsversorgung und sozialen Diensten. Sie erreichen schneller eine verbesserte Regierungsführung und produzieren dauerhaftere Friedensvereinbarungen. Die Basis für Beteiligung und Einflussnahme sind starke und unabhängige Frauenorganisationen und Netzwerke.
CARE unterstützt deshalb lokale Frauenrechtsorganisationen dabei, sich einzubringen und ihre Forderungen zu äußern, und ermutigt Frauen und Mädchen dazu, sich in lokalen Institutionen zu beteiligen und Akteure für ihre Entscheidungen zur Rechenschaft zu ziehen.
Von der Bundesregierung fordert CARE:
- Direkte und gezielte Unterstützung von Frauen- und Jugendorganisationen aus lokaler Zivilgesellschaft in Partnerländern. Dabei müssen Finanzierungsmechanismen so strukturiert sein, dass sie lokale Organisationen direkt erreichen und auch flexibel eingesetzt werden können.
- Anerkennung der Bedeutung lokaler Zivilgesellschaft durch politische Förderung. Lokale Organisationen sind diejenigen, die essenzielle Dienstleistungen zur Verfügung stellen, als Watchdog agieren und für die Rechte von Frauen und Mädchen vor Ort eintreten. Sie müssen deshalb eng in die Erarbeitung von Strategien und Entscheidungsprozesse auf allen Ebenen eingebunden werden.
- Das Eintreten für ein umfassendes Verständnis von sexueller und reproduktiver Gesundheit und Rechten (SRGR) auf Basis der Menschenrechte im internationalen Dialog sowohl mit anderen Gebern als auch mit Partnerländern. Das Recht auf Selbstbestimmung, informierte Entscheidungen und Nichtdiskriminierung muss durch die Bundesregierung engagiert verteidigt werden.
- Die Anerkennung der Rolle von Frauen und Mädchen als Ersthelferinnen und Akteurinnen des Wandels sowie als die besten Vertreterinnen ihrer Bedürfnisse in humanitären Krisen. Dies muss bei Förderungen explizit im Blick behalten werden.
Die negativen Folgen des Klimawandels
In vielen Weltregionen sind die Folgen der Klimakrise längst bittere Realität: Knapper werdende Wasserressourcen, Böden, die immer schneller veröden, aber allem voran unkalkulierbare Wetterzyklen mit Dürren und Überschwemmungen erschweren Menschen in vielen Regionen in Afrika, Mittel- & Südamerika und Asien den Kampf ums Überleben. In der Folge nehmen Konflikte um Wasser, Land und Holz zu. In vielen der betroffenen Länder setzt CARE Projekte um, die Menschen Unterstützung anbieten, um sich selbst gegen die Folgen des Klimawandels zu wappnen und widerstandsfähiger zu werden. Vor allem Frauen und Mädchen stehen im Fokus der Projekte von CARE, da sie häufig besonders von den negativen Folgen des Klimawandels betroffen sind. Sie haben oft weniger Zugang zu Ressourcen, um dem Klimawandel zu trotzen, sind rechtlich schlechter abgesichert, wenn sie ihre Lebensgrundlage verlieren und müssen vielerorts als Kleinbäuerinnen Dürre und Fluten trotzen, während sie die Hauptarbeit im Haushalt leisten.
Die Hauptursache für den menschgemachten Klimawandel ist die Verbrennung fossiler Energien wie Kohle, Öl und Erdgas. Wie andere G20-Staaten gehören Deutschland und die EU sowohl historisch als auch aktuell nach wie vor zu den Hauptverursachern des Problems. Weltweit sind die reichsten 10 Prozent der Menschheit für fast 50 Prozent der Treibhausgasemissionen verantwortlich. Die Last tragen jedoch die ärmsten Bevölkerungsschichten in Länden des Globalen Südens, obwohl sie nicht zur Entstehung des Problems beigetragen haben.
Deutschland trägt deshalb besondere Verantwortung dafür, die CO2-Emissionen schnell zu verringern und die besonders Betroffenen sowohl bei der Vorsorge gegenüber den Klimafolgen als auch im Umgang mit Klimaschäden zu unterstützen. Eine Verpflichtung ergibt sich hier auch aus den multilateralen Regelwerken wie der UN-Klimakonvention und dem dazugehörigen Paris-Abkommen, für deren ambitionierte Umsetzung CARE sich in Deutschland und international einsetzt.
CARE ist dabei nicht alleine aktiv
Mit den Erkenntnissen aus unseren Projekten sowie gezielt finanzierten Allianzen beeinflussen wir gemeinsam mit zivilgesellschaftlichen Partnern aus den Ländern des Globalen Südens nationale Regierungen und nationale, regionale und internationale Politikprozesse.
Dazu gehörten in den letzten Jahren Initiativen zu einer Multi-Akteurspartnerschaft zu Klimarisikofinanzierung, strategisch ausgerichtete Aktivitäten zur Beeinflussung geschlechtergerechter nationaler Klimapläne (jeweils mit BMZ-Finanzierung), oder fachlicher Input zur besseren Ausgestaltung des Green Climate Fund, des größten multilateralen UN-Klimafonds (mit Finanzierung der Internationalen Klimainitiative, IKI). Lokale Partner und CARE Länderbüros unter anderem in Ägypten, Madagaskar, Malawi, Ghana und Kenia sind dabei nicht nur gleichberechtigte Partner, sondern diejenigen, die fachliche Expertise sowie praktische Erfahrung aus dem eigenen Erleben einbringen.
In Deutschland engagieren wir uns seit vielen Jahren in der AG Klima und Entwicklung von VENRO (u.a. als Co-Sprecher) und sind Mitglied des großen zivilgesellschaftlichen Bündnisses „Die Klima-Allianz“. Gemeinsam mit Brot für die Welt, Germanwatch, Oxfam und der Heinrich-Böll-Stiftung verfolgen wir kritisch-konstruktiv die deutsche Klimafinanzierung.
International ist CARE Deutschland tragendes Mitglied des CARE Climate Justice Center, in dem viele Teile von CARE zusammenarbeiten und wo sich viele Studien und Positionspapiere zum Beispiel zu den UN-Klimaverhandlungen (COPs) finden.
CARE engagiert sich auch aktiv in Netzwerken wie dem Climate Action Network International (CAN I) oder der Pan-African Climate Justice Alliance (PACJA).
Von der Bundesregierung fordert CARE:
- Die deutschen Klimaschutzziele müssen konsequent am 1,5°C -Limit des Paris-Abkommens ausgerichtet werden.
- Die Bundesregierung muss die Förderung der Geschlechtergerechtigkeit als Leitprinzip in der Klimafinanzierung verankern. Innerhalb der existierenden bi- und multilateralen Finanzinstrumente muss Deutschland Maßnahmen zur Verbesserung des Zugangs von Organisationen mit spezifischem Fokus auf die Förderung von Frauen fördern, um der Realität Rechnung zu tragen.
- Die Bundesregierung muss die für die internationale Klimafinanzierung bereitgestellten Haushaltsmittel bis 2025 als fairen Beitrag zur Erfüllung des 100 Milliarden US-Dollar Versprechens schrittweise auf mindestens acht Mrd. Euro jährlich erhöhen. 50 Prozent dieser Mittel sollten für Anpassung an die Klimafolgen zur Verfügung gestellt werden
- Mit deutscher Unterstützung sollten durch innovative globale Finanzierungsmechanismen, wie etwa einer Flug- oder Schiffsverkehrsabgabe, zusätzliche Mittel zur Bewältigung von klimawandelbedingten Verlusten und Schäden in ärmeren Ländern mobilisiert werden.
CARE-Studien und Forderungen
Gemeinsames Positionspapier: Aufstockung der BMZ-Initiative “Selbstbestimmte Familienplanung und reproduktive Gesundheit für alle”
Durch die Förderung von Programmen für sexuelle und reproduktive Gesundheitsdienste, trägt die Initiative „Selbstbestimmte Familienplanung und reproduktive Gesundheit für alle“ des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung zur Senkung der Schwangerschafts-, Mütter- und Kindersterblichkeit bei und stärkt die sexuellen und reproduktiven Rechte von Frauen, Mädchen und anderen benachteiligten Gruppen weltweit. CARE Deutschland e.V., die Deutsche Stiftung Weltbevölkerung (DSW) und Plan International Deutschland e.V. begrüßen die Verlängerung der Initiative bis 2025, sehen jedoch eine pauschale Anrechnung multilateraler Mittel kritisch und fordern eine Aufstockung der finanziellen Mittel sowie transparentere Rechenschaftslegung über deren Verwendung. Das vorliegende Positionspapier formuliert Forderungen und Vorschläge zur konkreten Umsetzung der Revision.
Gemeinsame Stellungnahme: Die Geschlechterperspektive in der Krisenreaktion in der Ukraine berücksichtigen
März 2024. Mehr als zwei Jahre nach der Eskalation des Krieges in der Ukraine bleiben die humanitären Bedürfnisse von Frauen und Mädchen ungedeckt. Die geschlechtsspezifischen Auswirkungen des Krieges werden übersehen, bereits bestehende geschlechtsspezifische Ungleichheiten werden verschärft und Frauenrechts- und Frauenorganisationen werden von humanitärer Koordinierung, Entscheidungsprozessen und Finanzierungssystemen in der Ukraine weitgehend ausgeschlossen.
Gemeinsam mit ukrainischen und internationalen Organisationen ruft CARE deshalb Geber, UN-Organisationen und INGOs dazu auf, die Rolle von Frauen in humanitären Entscheidungsprozessen bedeutend zu stärken. Frauenrechts- und Frauenorganisationen müssen ausreichend und verlässlich finanziert werden, damit sie humanitäre Hilfe bereitstellen können, die den Bedürfnissen von Frauen und Mädchen gerecht wird.
Stellungnahme lesen (Englisch)
Zwei Jahre Eskalation in der Ukraine: Frauenorganisationen in der Bereitstellung von Angeboten für Überlebende geschlechtsspezifischer Gewalt unterstützen
Februar 2024. Wie in vielen Konflikt- und Kriegskontexten konnten wir auch in der Ukraine beobachten, dass geschlechtsspezifische Gewalt stark angestiegen ist: Insbesondere Frauen und Mädchen sind einem erhöhten Risiko von unter anderem konfliktbedingter sexueller Gewalt, intimer Partnergewalt, sexueller Ausbeutung und Missbrauch sowie Menschenhandel ausgesetzt. Die Bereitstellung von Unterstützungsangeboten für Überlebende geschlechtsspezifischer Gewalt (GBV) steht vor dem Hintergrund anhaltender Kämpfe und der weitgehenden Zerstörung von Infrastruktur insbesondere in den Frontgebieten vor beträchtlichen Herausforderungen. Ukrainische NGOs, insbesondere von Frauen geführte und Frauenrechtsorganisationen leisten einen entscheidenden Beitrag in der Versorgung von GBV-Überlebenden und der Gewaltprävention. Das CARE-Briefing „What Are the Major Challenges for Women and Girls to Access Quality GBV Services?“ fasst zentrale Herausforderungen zusammen, denen ukrainische Frauenorganisationen in der Bekämpfung geschlechtsbasierter Gewalt in der Ukraine begegnen und macht Empfehlungen an Geber, UN-Organisationen und internationale Nichtregierungsorganisationen.
Viel Verantwortung, wenig Wertschätzung: CARE-Studie zur Rolle von Hebammen in fragilen Kontexten am Beispiel von Irak und Côte d’Ivoire
November 2023. Um bestehende Bedarfe zu decken, fehlen weltweit in etwa 900.000 Hebammen. Dabei sind Hebammen Hilfe und Stütze für Frauen in absoluten Ausnahmesituationen und begleiten sie nicht nur während, sondern auch vor und nach der Geburt. In einer Fachstudie zeigt CARE am Beispiel von Hebammen im Irak und in Côte d’Ivoire wie diese als Akteurinnen des Wandels täglich durch persönlichen Einsatz ressourcenschwache und teils dysfunktionale Systeme ausgleichen. Da die Verantwortung für einen besseren Zugang zu sexueller und reproduktiver Gesundheit und Rechte nicht allein bei den Hebammen liegen kann, formuliert die Studie abschließend Empfehlungen für eine strukturelle Verbesserung der Lage.
10 Empfehlungen für den deutschen Bundeshaushalt 2024
Oktober 2023. Der vom Kabinett verabschiedete Entwurf für den Bundeshaushalt 2024 sieht verheerende Kürzungen für Entwicklungszusammenarbeit und humanitäre Hilfe vor: der Etat des BMZ soll um 640 Millionen Euro, die Mittel für humanitäre Hilfe sogar um 36 Prozent (entspricht 1 Milliarde Euro) sinken.
Zum Vergleich: Allein das umstrittene Dienstwagenprivileg kostet den Bundeshaushalt jährlich zwischen 3,1 und 5 Milliarden Euro. Laut Berechnungen des Umweltbundesamtes fließen jährlich insgesamt etwa 65 Milliarden Euro in solche umweltschädlichen Subventionen. Der Sockelbetrag für humanitäre Hilfe betrug im letzten Jahr 2,7 Milliarden – das ist ein Vierundzwanzigstel dieser umweltschädlichen Gelder, die oft nur wenigen zugutekommen.
Angesichts zahlreicher globaler Krisen muss Deutschland seiner internationalen Verantwortung als viertgrößte Volkswirtschaft der Welt gerecht werden.
CARE fordert deshalb unter anderem:
• Keine Kürzungen der Mittel für humanitäre Hilfe und Entwicklungszusammenarbeit
• Flexiblere, unbürokratischere und stärkere Förderung lokaler zivilgesellschaftlicher Organisationen, insbesondere feministischer und frauengeführter Organisationen
• Anstieg der Mittel für die ökonomisch schwächsten Länder (LDC) auf mindestens 0,2 Prozent des BNE
• Konkrete und ambitionierte Finanzierungsziele für die Bereiche geschlechtsspezifische Gewalt (GBV) und sexuelle und reproduktive Gesundheit und Rechte (SRGR)
Bewertung der feministischen Leitlinien und Strategie
[English see below]
April 2023. Im März 2023 hat das Auswärtige Amt unter Annalena Baerbock die mit Spannung erwarteten 'Leitlinien für feministische Außenpolitik' vorgestellt. Gleichzeitig präsentierte Bundesministerin für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ), Svenja Schulze, die 'Strategie Feministische Entwicklungspolitik'.
Wir begrüßen die Ankündigungen eines feministischen Umdenkens in Außenpolitik und Entwicklungszusammenarbeit. Doch welchen Beitrag können die vorgestellten Papiere auf diesem Weg tatsächlich leisten? Welche Maßnahmen und Zielsetzungen scheinen vielversprechend und wo sehen wir noch Luft nach oben?“
April 2023. In March 2023, the Federal Foreign Office, headed by Annalena Baerbock, presented the eagerly awaited 'Guidelines for Feminist Foreign Policy'. At the same time, Federal Minister for Economic Cooperation and Development (BMZ), Svenja Schulze, presented the equally long-awaited 'Strategy Feminist Development Policy'.
We welcome the announcements of a feminist rethinking of foreign policy and development cooperation. But what contribution can the presented papers actually make on this path? Which measures and objectives seem promising and where do we still see room for improvement?
Frauenorganisationen in der Ukraine: Wenn internationale Finanzierung Hilfe verkompliziert
Februar 2023. Ein Jahr nach der Eskalation des Krieges in der Ukraine übernehmen Frauenrechts- und frauengeführte Organisationen weiterhin eine zentrale Rolle in der Bereitstellung von humanitärer Hilfe, sowohl in der Ukraine als auch in ihren Nachbarländern. Die Kapazitäten dieser Organisationen, lebensrettende Unterstützung bereitzustellen, werden allerdings von erheblichen Herausforderungen bei der Finanzierung ihrer Arbeit behindert. Das Briefing Making International Funding Work for Women's Organisations fasst zusammen, mit welchen Problemen 14 Frauenrechts- und frauengeführten Organisationen in der Ukraine, Polen, Ungarn und Rumänien kämpfen, um Hilfe zu den vulnerabelsten Menschen zu bringen, und macht Empfehlungen an Geber, UN-Organisationen und internationale Nichtregierungsorganisationen.
Positionspapier: Wie kann eine feministische Entwicklungspolitik einen Beitrag zur Stärkung von Demokratie und Governance leisten?
Januar 2023. Im Januar 2023 veröffentlicht das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) eine neue Afrika-Strategie, die die Neuausrichtung der Zusammenarbeit des Ministeriums mit dem afrikanischen Kontinent beschreiben soll. Im Sinne einer feministischen Entwicklungspolitik, der sich das Ministerium verschrieben hat, sollten sich auch in der Afrikastrategie feministische Ansätze deutlich widerspiegeln.
Das Positionspapier formuliert zivilgesellschaftliche Empfehlungen wie feministische Ansätze in der Afrikastrategie verankert und umgesetzt werden sollten.
Diese Empfehlungen wurden im Rahmen des Konsultationsprozesses 2022 zur neuen Afrikastrategie von CARE und BEA e.V. in Kooperation mit afrikanischen feministischen Organisationen und Diasporaorganisationen entwickelt. Sie bildeten die Grundlage für die Podiumsdiskussion zur feministischen Entwicklungspolitik in der neuen Afrikastrategie auf dem Tag der Zivilgesellschaft am 4. Juli 2022 und wurden dem Ministerium überreicht.
Positionspapier: Annäherung an eine feministische Außenpolitik Deutschlands
August 2022. Im „Koalitionsvertrag 2021-2025“ bekennt sich die deutsche Bundesregierung zu einer feministischen Außenpolitik. Doch wie kann und sollte eine solche feministische Außenpolitik für Deutschland aussehen?
Das Positionspapier versucht sich einer solchen Definition anzunähern. Es formuliert Empfehlungen, wie eine feministische Außenpolitik kohärent institutionalisiert und durch Gender Budgeting im Haushalt verankert werden sollte.
Und es stellt dar, wie feministische Außenpolitik beispielsweise im Multilateralismus, der Entwicklungspolitik, der humanitären Hilfe, im Bereich Flucht und Migration, bei der Bekämpfung von sexualisierter und geschlechtsspezifischer Gewalt sowie in der Klimaaußenpolitik umgesetzt werden sollte.
Sechs Monate Eskalation in der Ukraine: Kaum Beteiligung von Frauenorganisationen bei der humanitären Entscheidungsfindung
August 2022. Sechs Monate nach der Eskalation des Ukraine-Konfliktes sind Frauen weiterhin maßgeblich als Ersthelferinnen in der humanitären Hilfe tätig und nehmen Führungspositionen bei der Implementierung von Hilfsmaßnahmen ein. Trotzdem werden Frauenrechtsorganisationen und frauengeführte Organisationen kaum bei der Entscheidungsfindung und Koordinierung von Hilfsmaßnahmen beteiligt. CARE verstärkt deswegen in beigefügtem Statement die Perspektiven von einigen unserer frauengeführten Partnerorganisationen in der Ukraine, Polen und Rumänien.
Gender-Analyse zur Ukrainekrise
Mai 2022. Die Rapid Gender Analysis (Gender-Schnellanalyse) von CARE und UN Women untersucht die geschlechtsspezifische Dynamik der humanitären Krise in der Ukraine und zeigt auf, dass Frauen und marginalisierte Gruppen besonders stark von den Auswirkungen des Krieges betroffen und spezifischen Risiken ausgesetzt sind. Seit Beginn des Krieges sind viele Frauen allein für ihre Familien verantwortlich und übernehmen in der humanitären Versorgung vor Ort eine zentrale Rolle. Dennoch bleiben sie von formalen Entscheidungsprozessen auf Verwaltungsebene, in der humanitären Hilfe und im Friedensprozess weitgehend ausgeschlossen. Basierend auf den Ergebnissen der Befragung spricht der Bericht Empfehlungen für humanitäre Akteur:innen und Geberregierungen aus, um sicherzustellen, dass geschlechtsspezifische Risiken und Potenziale in der humanitären Hilfe berücksichtigt werden.
„She Told Us So (Again)“ – Auswirkungen von COVID-19 auf Frauen und Mädchen
Schlagworte: COVID-19, Gesundheit, Beteiligung, Women Lead in Emergencies
März 2022. Der Bericht „She Told Us So (Again)“ zeigt, dass die weltweiten Auswirkungen der COVID-19-Pandemie im Jahr 2022 schlimmer sind als im September 2020. Frauen und Mädchen, mit denen CARE auf der ganzen Welt zusammenarbeitet, berichten, dass sich ihre Situation im Vergleich zum September 2020 weiter verschlechtert hat, da die COVID-19-Pandemie anhält und sich nun auch noch mit anderen Krisen überschneidet. Die neue Untersuchung legt dar, wie sich die COVID-19-Pandemie seit der Veröffentlichung des CARE-Berichtes „She Told Us So“ im Oktober 2020 auf Frauen ausgewirkt hat und welche Bedürfnisse für die Befragten vorrangig sind. Außerdem zeigt der Bericht Beispiele für die Führungsrolle von Frauen zur Bewältigung der COVID-19-Folgen auf und spricht konkrete politische Empfehlungen aus.
Merkzettel für die Legislaturperiode
Dezember 2021. Im Herbst 2021 hat Deutschland eine neue Regierung gewählt. An ihr ist es nun, in den kommenden vier Jahren die richtigen Weichen zu stellen, auch in den Bereichen der Humanitären Hilfe und Entwicklungszusammenarbeit. Damit die für uns besonders wichtigen Themen dabei nicht zu kurz kommen, haben wir einen praktischen Merkzettel für die laufende Legislaturperiode entworfen.
CARE Policy Paper zur Situation von Geflüchteten auf dem westlichen Balkan
Dezember 2021. Winter, Pushbacks, COVID-19: Im Policy Paper zur Situation von Geflüchteten auf dem westlichen Balkan beleuchten wir Hintergründe und geben Empfehlungen an politische Akteur:innen zur Verbesserung der derzeitigen Situation ab.
CARE & IRC Policy Brief: Geschlechtsspezifische Gewalt in humanitären Krisen beenden
November 2021. Der gemeinsame Policy Brief von CARE und IRC legt die Problematik von geschlechtsspezifischer Gewalt (GBV) in humanitären Krisen, die mangelnde Priorisierung von GBV-Maßnahmen und lokalen Frauenorganisationen sowie Deutschlands Beitrag im Bereich GBV dar. Darauf basierend werden Handlungsempfehlungen an die Politik ausgesprochen.
Der Einfluss von COVID-19 auf die Gesundheit und die Versorgung von Frauen und Mädchen auf der Flucht - Ungleichheiten und sich verstärkende Risiken
Juni 2021 - CARE USA
Schlagworte: Gender in Emergencies, COVID-19, Flucht, SRHRiE, GBViE, Gesundheit
Während der COVID-19 Pandemie haben sich die ohnehin bestehenden Probleme in der Gesundheitsversorgung und beim Schutz von Frauen und Mädchen auf der Flucht weiter verschlechtert. Der von CARE im Juni 2021 veröffentlichte Bericht basiert auf Befragungen von geflüchteten Frauen und Frauen in Aufnahmegemeinden in Afghanistan, Ecuador und der Türkei. Die Ergebnisse zeigen, dass der Zugang von geflüchteten Frauen und Mädchen zu Gesundheitsdienstleistungen, einschließlich sexueller und reproduktiver Gesundheit (SRG), und Schutzdiensten seit Ausbruch der Pandemie noch stärker eingeschränkt ist als zuvor. Außerdem ist mit der Pandemie das Risiko gestiegen, Opfer von geschlechtsspezifischer Gewalt zu werden, und Armut und Ernährungsunsicherheit sind gestiegen. CARE fordert deshalb, dass COVID-19 Maßnahmen und andere humanitäre Hilfsmaßnahmen immer gendersensibel gestaltet werden müssen, um die Bedürfnisse von Frauen und Mädchen zu berücksichtigen und die Position von Frauen und Mädchen zu stärken.
CARE-Positionen zur Bundestagswahl 2021
März 2021. Mehr Geschlechter- und Klimagerechtigkeit - Forderungen an die deutsche Entwicklungs- und Außenpolitik
für die Bundestagswahl 2021 und darüber hinaus.
Wie Hilfeleistungen systematisch Frauen und Mädchen in Konflikten benachteiligen
März 2021 - CARE International UK
Schlagworte: Women and Girls in Crisis, Lokalisierung, Finanzierung, Beteiligung, Women Leadership
Der Bericht untersucht die wichtigsten staatlichen Geber und UN-Organisationen hinsichtlich der Finanzierung von Frauenrechtsorganisationen und frauengeführten Organisationen, Finanzierung von Programmen zur Geschlechtergerechtigkeit und Förderung von Leadership und gleichberechtigter Beteiligung von Frauen und Frauenorganisationen in humanitären Kontexten. CARE zeigt in dem Bericht auf, dass UN-Organisationen und Geberstaaten keine ausreichenden Maßnahmen ergriffen haben, um Frauen und Mädchen in den Mittelpunkt der Krisenreaktion zu stellen.
Besserer Wiederaufbau: Schaffung einer gerechteren, geschlechtergerechten, inklusiven und nachhaltigen Welt
Oktober 2020 - CARE International UK
Schlagworte: Building Forward, COVID-19 - Response, Beteiligung, Finanzierung, Gesundheit
Frauen sind in besonderer Weise von den Auswirkungen der COVID-19-Pandemie betroffen, doch bei der Reaktion auf die Krise sind sie oft nicht an Entscheidungen beteiligt. Der Wiederaufbau nach der Pandemie bietet nun die Möglichkeit, nicht nur wieder zum vorher bestehenden Status quo zurückzukehren, sondern neue, faire Lebensverhältnisse besonders für Frauen, aber auch für die gesamte Gesellschaft zu schaffen. Der Bericht zeigt auf, wie dies umgesetzt werden kann, indem alle Akteur:innen der Gleichstellung der Geschlechter in ihren Strategien für den wirtschaftlichen und finanziellen Wiederaufbau, die Umweltpolitik und die humanitäre Hilfe Priorität einräumen und Frauen und Mädchen auf allen Ebenen in die Entscheidungsfindung einbezogen werden.
Rolle und Bedürfnisse von Mädchen und jungen Frauen in COVID-19 Maßnahmen und darüber hinaus
Oktober 2020 - CARE USA
Schlagworte: Girl-Driven Change, GBV, COVID-19, Gesundheit, Beteiligung, SRGR
Die COVID-19 Pandemie hat global eine Krise ungeahnten Ausmaßes ausgelöst, durch die insbesondere Mädchen und junge Frauen Risiken ausgesetzt sind. CARE nutzt Daten aus eigenen Projekten, um auf die Auswirkungen der Pandemie auf die Gesundheit, das Wohlergehen und die Sicherheit junger Frauen sowie ihren Zugang zu und Beteiligung an wichtigen Diensten aufmerksam zu machen. Der Bericht enthält Empfehlungen, wie Geberstaaten und andere wichtige Akteur:innen die Bedürfnisse von Mädchen inmitten der Krise besser erkennen und mit ganzheitlichen, rechtebasierten und jugendzentrierten Initiativen auf diese reagieren können.
Policy Briefing zum Dritten Nationalen Aktionsplan der Bundesregierung
Juni 2020. 17 Nichtregierungsorganisationen formulieren Empfehlungen an die Bundesregierung zur Umsetzung der UN-Resolution 1325 "Frauen, Frieden und Sicherheit", darunter medica mondiale, CARE Deutschland, Centre for Feminist Foreign Policy und das Gunda-Werner-Institut der Heinrich-Böll-Stiftung. Zentrale Forderung des Papiers “Die Agenda Frauen, Frieden und Sicherheit. Was zählt, ist die Implementierung“ ist, Geschlechtergerechtigkeit in allen Politikfeldern der Außen- und Innenpolitik zu verwirklichen.
Chancen durch die Beteiligung von Frauen in Führungspositionen bei COVID-19-Maßnahmen
Juni 2020 - CARE International
Schlagworte: #SheLeadsInCrisis, COVID-19, Beteiligung, Gesundheit, GBV
Die Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus haben auch zu einem Anstieg von geschlechtsspezifischer Gewalt, insbesondere häuslicher Gewalt geführt. Gleichzeitig wurde der Zugang zu grundlegender Gesundheitsversorgung gerade im Bereich der reproduktiven Gesundheit eingeschränkt. Doch auch bei der medizinischen Versorgung von Coronainfizierten sind als Pflegepersonal in erster Linie Frauen vertreten und dadurch einem höheren Infektionsrisiko ausgesetzt. Der Bericht von CARE untersucht, wie hoch die Beteiligung von Frauen in nationalen COVID-19-Krisenstäben ist und wie die zur Verfügung stehenden Mittel genutzt werden. Der CARE-Bericht zeigt, dass Frauen in der Mehrheit der untersuchten nationalen COVID-19-Krisenstäben unterrepräsentiert sind und nur sehr wenige der untersuchten Länder ausreichend geschlechtsspezifische Maßnahmen oder Strategien in ihren COVID-19-Reaktionsplänen beschlossen haben.
Geschlechtsbasierte Gewalt – Die Schattenpandemie
Mai 2020 – CARE USA
Schlagworte: GBV, COVID-19, Gesundheit
Während der Coronapandemie ist geschlechtsspezifische Gewalt deutlich angestiegen. Diese „Schattenpandemie“ findet oft zu wenig Beachtung, darf jedoch bei der Krisenreaktion nicht vergessen werden. Der Bericht von CARE arbeitet heraus, wie Lockdowns die Sicherheit und Gesundheit von Frauen und Mädchen gefährden können und wie die Hilfsmaßnahmen gestaltet werden sollten, damit Frauen und Mädchen die notwendige Unterstützung zukommt.
Kontakt




Politische Adressat:innen
Auswärtiges Amt
Fragen der humanitären Hilfe sind in Deutschland im Auswärtigen Amt (AA) angesiedelt. CARE ist Mitglied im Koordinierungsausschuss Humanitäre Hilfe und nimmt als zivilgesellschaftlicher Partner an den Sitzungen der interministeriellen Arbeitsgruppe 1325 teil, die die Umsetzung der Agenda Frauen, Frieden, Sicherheit in Deutschland begleitet. In Länder- und Regionalgesprächen vertreten wir die Anliegen unserer Partner und Partnerorganisationen und vermitteln so oft wie möglich, dass diese direkt mit deutschen Entscheidungsträger:innen in Kontakt treten können.
Ausschuss für Menschenrechte und humanitäre Hilfe
Der Ausschuss für Menschenrechte und humanitäre Hilfe befasst sich mit humanitären Fragen und Problemen. Der Ausschuss lässt sich über die humanitären Hilfsmaßnahmen der Bundesregierung unterrichten, organisiert öffentliche Anhörungen mit Expert:innen und legt Beschlussempfehlungen und Berichte vor. CARE wendet sich an den Ausschuss für Menschenrechte und humanitäre Hilfe, um basierend auf unseren Erfahrungen vor Ort über aktuelle Entwicklungen und Probleme im Bereich der humanitären Hilfe zu informieren, politische Empfehlungen auszusprechen und Unterstützung für unsere Anliegen zu generieren.
Ausschuss für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung
Der Ausschuss für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung beschäftigt sich mit den inhaltlichen Themen und der Umsetzung der deutschen Entwicklungszusammenarbeit. Der Ausschuss lässt sich von den zuständigen Stellen über die deutsche Entwicklungszusammenarbeit unterrichten, organisiert öffentliche Anhörungen mit Vertreter:innen der Bundesministerien und der Zivilgesellschaft und legt Beschlussempfehlungen und Berichte vor. CARE wendet sich an den AWZ um basierend auf der Erfahrung aus unseren Projekten vor Ort auf erfolgreiche Ansätze insbesondere zu Geschlechtergerechtigkeit und sexueller und reproduktiver Gesundheit und Rechten in fragilen Kontexten zu informieren und politische Empfehlungen auszusprechen.
Bundeskanzleramt
Das Bundeskanzleramt unterstützt die Arbeit der/des Bundeskanzlers/in, hält Kontakt zu allen Ministerien und koordiniert deren Arbeit. Das Bundeskanzleramt spiegelt die Arbeitsbereiche der Ministerien in Spiegelreferaten und stellt daher auch eine Adressatin für die politische Arbeit von CARE dar.
Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung
Im Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) ist der Bereich der Übergangshilfe angesiedelt, die besonders in den Regionen der Welt Projekte finanziert, die von langanhaltenden, komplexen und wiederkehrenden Krisen betroffen sind. Im BMZ bringt sich CARE Deutschland vor allem im Gender Themen Team und zu den Themen sexuelle und reproduktive Gesundheit und Rechte (SRGR) und geschlechtsbasierte Gewalt (GBV) in fragilen Kontexten ein.
Koalitionen
Klima-Allianz Deutschland
Die Klima-Allianz Deutschland ist das breite gesellschaftliche Bündnis für den Klimaschutz. Mit ihren 115 Mitgliedsorganisationen aus den Bereichen Umwelt, Kirche, Entwicklung, Bildung, Kultur, Verbraucherschutz, Jugend und Gewerkschaften setzt sie sich für eine ambitionierte Klimapolitik und eine erfolgreiche Energiewende auf lokaler, nationaler, europäischer und internationaler Ebene ein. Ihre Mitgliedsorganisationen repräsentieren zusammen rund 20 Millionen Menschen.
VENRO
CARE Deutschland e.V. ist Mitglied im Verband Entwicklungspolitik und Humanitäre Hilfe deutscher Nichtregierungsorganisationen e.V. (VENRO), dem freiwilligen Zusammenschluss von rund 140 privaten und kirchlichen Trägern der Entwicklungszusammenarbeit, Nothilfe und entwicklungspolitischen Bildungs- und Lobbyarbeit. CARE stellt derzeit die Co-Sprecher:innen der Arbeitsgruppen Gender, Klima sowie humanitäre Hilfe und gestaltet so aktiv die Arbeit des Verbands mit.


